Im Kino
Reingehört in die Strukturen
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, André Malberg
10.05.2024. Am Montag endeten die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Es gab faszinierende Filme wie etwa Abraham Ravetts "Lunch with Fela", Johannes Lehnens "Merkur" und Nicolaas Schmidts "Like Horses Standing in the Rain". Aber auch die Querelen um das Festival selbst und seine israelsolidarische Position lohnen eine Rekonstruktion. Anders als seine Gegner kämpft Festivalchef Lars Henrik Gass mit offenem Visier.1

In Abraham Ravetts "Lunch with Fela" taucht eine Einstellung lang Oberhausen auf. Einige Sekunden lang sehen wir einen mit einer 8mm-Kamera aufgezeichneten, gleich auf den ersten Blick sehr westdeutschen Straßenzug. Die Aufnahme stammt aus den frühen Nullerjahren. Im Publikumsgespräch nach dem Film auf den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen 2024 erzählt Ravett, dass er dieselbe Straße auch in diesem Jahr aufgesucht - und sofort wiedererkannt habe. Nichts habe sich dort seit dem vorherigen Besuch verändert.
Dass die Uhren langsam gehen in Oberhausen, einer Stadt, in der die alte BRD der Vorwendezeit noch fast an jeder Straßenecke auf die eine oder andere Art sichtbar scheint, macht einen Teil des Reizes des örtlichen Kurzfilmfestivals aus. Die wagemutigen Filmexperimente aus Nah und Fern, die man hier zu Gesicht bekommt, und die sich gelegentlich ein wenig forciert Mühe geben, "am Puls der Zeit" zu sein, werden in eine Stadt hineingestellt, deren Begriff von Mondänität auf dem Stand der 1950er bis 1980er Jahre eingefroren scheint; wie etwa im zauberhaften Café Transatlantik schräg gegenüber der Lichtburg, dem zentralen Festivalkino: Ein Hauch von Fernweh verbunden mit, und gefesselt von, grundsolider Ruhrgebietgemütlichkeit weht durch dieses, seinerseits ebenfalls in einem alten Kinofoyer installierte Lokal.
Ravetts "Lunch with Fela" - vorgeführt im Rahmen eines dem Regisseur gewidmeten Spezialprogramms - ist eine Zeitmaschine eigener Art. Dreh- und Angelpunkt des Films sind die Besuche des Regisseurs am Kranken- beziehungsweise prospektiven Sterbebett seiner Mutter. Aufgezeichnet sind sie mit einer handlichen Mini-DV-Kamera, die neben dem Bett der Mutter platziert ist. Die Tür des Krankenhauszimmers bleibt während der Filmaufnahmen geschlossen, das Zimmer selbst wird zum Schutzraum, vielleicht auch zu einer Dunkelkammer, in der das Bild eines Lebens "entwickelt" wird. Und in die freilich wir als Außenstehende zauberhafterweise Einblick erhalten.
Emphatisch bedient sich Ravett der Form des Tagebuchfilms. (Auto)biografische Zeit, diese Erkenntnis steckt in dem Film, ist eine unerbittlich linear voranschreitende Zeit: immer dem Tod entgegen. Zunächst scheint sie formbar, dem eigenen Willen unterworfen, mit zunehmendem Alter gerät sie jedoch mehr und mehr in die Klauen der Biologie, irgendwann muss ihr jeder Atemzug, jeder Ausflug in den Krankenhausgarten mühsam abgerungen werden. Die Erinnerung, als Reflexionsmedium des Biografischen, dient dem eigenen Lebenslauf als ein Kitt, der immer brüchiger wird. Aber manches bleibt. Was der Ausdruck "KZ" bedeutet, wird Ravetts Mutter, eine Holocaust-Überlebende, nie vergessen.
Im Akt des (auto-)biografischen Schreibens oder Filmens wird die biografische Zeit freilich stets auch angehalten, objektiviert. Schreibend/filmend hinterlässt man eine materielle Spur in der Zeit. Eine Spur, die auf andere Spuren verweist, sich zu ihnen in Beziehung setzt. Tatsächlich kann man "Lunch with Fela" vielleicht weniger als ein filmisches Tagebuch - englisch diary - fassen, denn als ein filmisches scrap book, also eines jener Erinnerungsbücher, in die Fotografien und andere materielle Objekte geklebt und um schriftliche Notizen ergänzt sind. Die zumeist nicht harte, sondern durch neutrale Zwischenbilder abgemilderte Montage des Films ähnelt dem Blättern in einem solchen scrap book. Wir verfolgen nicht, als voyeuristische Beobachter, gebannt das intime Drama eines (fremden) Tagebuchs, sondern lassen gewissermaßen jede Buchseite für sich auf uns einwirken.
Das Material ist disparat, aber nie willkürlich. Zwischen den Bildern aus dem Krankenhaus präsentiert Ravett zum Beispiel immer wieder Alltagsgegenständen, die in sorgfältigen, behütenden Großaufnahmen präpariert werden. Einige davon wurden, heißt es einmal im Film, von Ravetts früh verstorbenem Vater hergestellt, einem polnischstämmigen Schneider. Das Schneidern, beziehungsweise allgemeiner das Handwerkliche, wäre neben dem Tagebuch / scrap book eine weitere Metapher für Ravetts mit liebevoller Präzision gearbeiteten Film. In dem gleichwohl das Wissen um den hybriden, illusionistischen, mit dem Ethos eines klassischen Handwerkberufs gerade nicht kompatiblen Charakter des Filmischen steckt.
Als eine Denkform ist das Filmische letztlich doch immer näher an der Sprache als an der Dingen. Tatsächlich ist "Lunch with Fela" auch ein Film der Sprache. Beziehungsweise der Sprachen, der Mehrsprachigkeit, der Akzente und Dialekte. Deutsche, englische, jiddische, hebräische, polnische Sätze fallen in "Lunch with Fela", längst nicht immer ist klar, wer sie spricht, und auch nicht, wann sie aufgenommen wurden. Nichts gewonnen wäre mit dem Versuch, jeden Sprachschnipsel dingfest zu machen, historisch zu verorten. Sprache verändert sich, aber sie bewahrt auch Ungleichzeitiges in sich auf. Soziale Zeitlichkeit, in Sprache gebannt, schreitet nicht linear und zielstrebig voran, eher kumulativ und chaotisch. Einzelne Menschen können nicht gleichzeitig alt und jung sein, Gesellschaften können das durchaus.
2
Man muss - leider Gottes - wieder mit dem 7. Oktober 2023 beginnen. Noch während Hamas-Kämpfer, unterstützt von anderen palästinensischen Gruppierungen, in Südisrael einfielen, wahllos mordeten und vergewaltigten, verteilten Mitglieder des inzwischen verbotenen "Solidaritätsnetzwerks für palästinensische Gefangene" Samidoun auf der Berliner Sonnenallee zur Feier des Tages Süßigkeiten. Außerdem kam es zu spontanen antiisraelischen Demonstrationen - all dies wohlgemerkt, bevor die israelische Militäroperation im Gaza-Streifen begann.
Es erscheint keineswegs abwegig, Menschen, die unmittelbar nach einem antisemitischen Massaker - die entsprechenden Bilder verbreiteten die Täter selbst via Social Media, auf Unkenntnis kann sich also niemand berufen - Leckereien unter die Leute bringen und in Jubelstürme ausbrechen, als Judenhasser zu bezeichen. Die Sonnenallee wiederum liegt nun einmal in Neukölln, einem Stadtteil, der seit Jahren mit teils boulevardjournalistischen Methoden und fremdenfeindlicher Rhetorik als sozialer Brennpunkt inszeniert wird; der aber eben in der Tat, worauf etwa Güner Balci, Integrationsbeauftragte des Bezirks, immer wieder verweist, ein ernsthaftes Problem mit Antisemitismus, insbesondere im Umfeld radikal islamistischer Organisationen hat.
Entsprechend formulierte denn auch Lars-Henrik Gass, Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen, knapp zwei Wochen später auf dem Facebook-Kanal der Kurzfilmtage in einem Posting, das auf eine israelsolidarische Demonstration in Berlin hinwies: "Zeigt der Welt, dass die Neuköllner Hamasfreunde und Judenhasser in der Minderheit sind." Als eine pauschalisierende, gar rassistische Verleumdung der Bewohner Neuköllns kann man den Satz nur dann missverstehen, wenn man seinen Kontext - ansonsten ein Lieblingswort der jüngeren Israelkritik - außer Acht lässt; nämlich, eben, die medial breit rezipierten Freudenfeiern auf der Sonnenallee am 7. Oktober und den Folgetagen.
Anders ausgedrückt: missverstehen kann diesen Satz nur, wer ihn missverstehen will. Kurz nach dem Facebook-Posting tauchte in den Tiefen des Internets eine "Message to the international film community, regarding a recent statement from the director of Internationale Kurzfilmtage Oberhausen" auf - ein anonym verfasster offener Brief, der Gass vorwarf, mit seinem Posting "alle Personen, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen, zu dämonisieren", und Filmemacher, Verleihfirmen, Kuratoren sowie Gäste des Festivals dazu aufforderte, "ihre Position hinsichtlich der Kurzfilmtage zu überdenken". Ein Boykottaufruf, der das Wort "Boykott" vermeidet. Selbstverständlich finden auch die Süßigkeiten auf der Sonnenallee nach dem Judenmord keine Erwähnung. Tatsächlich taucht im offenen Brief, ein wiederkehrendes Motiv der jüngeren "Palästinasolidarität", nicht einmal das Massaker des 7. Oktobers auf.
Mit offenen Karten spielten die Briefeschreiber von Anfang an nicht. Die Vermutung liegt, erst recht von heute aus betrachtet, mehr als nur nahe, dass nicht Gass' Neukölln-Satz, sondern die unmissverständliche Solidarität der Kurzfilmtage mit Israel Triebfeder der Boykottbewegung war und ist. In gewisser Weise war die Sache von Anfang an entschieden. Dennoch lohnt es sich, diesen flame war - der selbstverständlich erst einmal nichts anderes ist als Webkultur business as usual - noch einmal ausführlich zu rekonstruieren. Und zwar zum einen, weil der Konflikt um die Kurzfilmtage hier und da als Provinzposse beziehungsweise deutsches Sonderproblem abgetan wurde, in der Tat jedoch, wie unter anderem die jüngsten Ereignisse an amerikanischen Universitäten belegen, Teil eines weltweiten Kontinuums aktivistischer Enthemmung ist; und zum anderen, weil sich an ihm beispielhaft einige Merkmale des medialen Meltdowns rund ums Thema Israel/Gaza studieren lassen.
Dazu zählt eben die "bad faith"-Argumentation, also das absichtsvolle Missverständnis. Dass die anonyme Nachricht an die internationale Filmgemeinschaft keineswegs als Beitrag zu einer Diskussion mit offenem Ausgang intendiert war, zeigte sich spätestens, als Gass und die Kurzfilmtage zwei Wochen nach dem schicksalhaften Posting ebenfalls via Facebook ein Statement veröffentlichten, das klarstellte, was tatsächlich, siehe oben, gar nicht klargestellt hätte werden müssen: dass es nicht darum ging, "die palästinensische Bevölkerung pauschal zu stigmatisieren" - sondern eben darum, Antisemitismus zu benennen und zu verurteilen. Gass verwies außerdem auf den emotionalen Charakter seiner Wortmeldung, im Angesicht eben jener Ereignisse, die für die Briefeschreiber nicht einmal eine Erwähnung wert waren.
Eine Diskussion im Habermasschen Sinne - auf der Grundlage wechselseitig kritisierbarer Geltungsansprüche - hätte spätestens an diesem Punkt ihr Ende finden müssen. Tatsächlich jedoch beharrten die Briefeschreiber, selbstverständlich ohne weitere Argumente nachzuliefern, auf ihrer Position. Die Reaktion des Festivals, hieß es in einem follow-up-Statement, sei, was sonst, "zutiefst beunruhigend" und trage gar dazu bei, darunter macht man es heutzutage nicht in aktivistischen Kreisen, "Menschen inner- wie außerhalb Deutschlands zu gefährden". Schon in der ersten Nachricht war die einigermaßen bizarre Behauptung aufgestellt worden, es bestünde eine "unerträgliche Verbindung zwischen den Kurzfilmtagen Oberhausen und staatlicher Gewalt gegen Palästinenser in Deutschland". Man könnte eine solche Formulierungen als ernthafte Anzeichen eines Realitätsverlusts deuten; tatsächlich geht es wohl eher darum, eine eigenständige, lediglich im Kreis der eigenen peers konsenspflichtige Gegenrealität herzustellen. Eine, in der sich ein kleines, einigermaßen widerborstiges Festival, das verschrobene Kunstfilme aus aller Welt präsentiert, in eine Armada repressiver staatlicher Institutionen einreiht. Was im Umkehrschluss den Akt, einen Film hier nicht zu präsentieren, zu einer politischen Handlung erhebt.
Diese Form der rhetorischen Eskalation verweist auf ein weiteres Merkmal der zeitgenössischen Debattenkultur: auf einen mismatch zwischen (nichtiger) Ursache und (gewaltiger) Wirkung. Denn schließlich begann alles, noch einmal, mit einem einzigen Facebook-Post. Der noch dazu lediglich ein paar Dutzend Reaktionen nach sich zog - in deutlicher Mehrzahl positive, nebenbei gesagt. Nur eine Handvoll Facebooknutzer suchten im Kommentarbereich den Dialog; der anonym verfasste Brief an die internationale Filmgemeinschaft wurde hingegen von knapp zweitausend Menschen, teils mit Klarnamen, unterschrieben. Im Anschluss machten insbesondere einige Kurzfilmverleihfirmen Nägel mit Köpfen und zogen ihre festivalseitig fest eingeplanten Programmpräsentationen zurück. Auch ein umfangreiches Themenprogramm zum Sportfilm musste massiv umgebaut werden; Teile des Kuratorenteams hatten den offenen Brief unterzeichnet.
Ist diese Darstellung parteiisch? Vermutlich ja. Nicht verschwiegen werden soll, dass Lars-Henrik Gass gelegentlich durchaus auch ein bisschen Spaß an provokanten bis polemischen Statements zu haben scheint, nicht nur in Bezug auf den Nahost-Konflikt. Vielleicht verbringt er auch schlicht gelegentlich zu viel Zeit auf sozialen Netzwerken. Das gilt freilich für viele seiner Gegner genauso. (Für mich auch.) Aber er kämpft, und das macht in der Sache einen Unterschied ums Ganze, mit offenem Visier, verteidigte seine Haltung in den Monaten nach dem Boykottaufruf in Essays und Interviews ausführlich und differenziert.
Aus den folgenden Querelen sei nur noch ein möglicherweise sprechendes Detail herausgegriffen: Auf dem - hier und da als rechtslastig verleumdeten, tatsächlich dem liberalen Spektrum zugehörigen - Blog Ruhrbarone, aber auch im Perlentaucher schalteten die Kurzfilmtage kurz vor Festivalbeginn eine Anzeige mit dem Werbetext "Pro-zionist rated by BDS". Man mag das als eine nicht unbedingt in jeder Hinsicht durchdachte PR-Aktion mit leichter Internettroll-Schlagseite kritisieren; oder eben als Beleg dafür nehmen, dass die Kurzflilmtage Oberhausen, im Gegensatz zu ihren Kritikern, über Sinn für Humor verfügen.
Das wäre denn auch das dritte und, versprochen, letzte hier aufgelistete Merkmal unserer Social-Media-Diskursgegenwart: ihre pathosbesoffene Komplettunentspanntheit (von der, sicher, auch die israelsolidarische Seite längst nicht immer frei ist). Ein weiteres Mal spricht die Wortwahl der anonymen Briefeschreiber Bände: Die Kurzfilmtage begnügen sich laut ihren Anklägern (nun im englischen Original) nicht damit, "(to) demonize any person who shows solidarity with Palestinian liberation." Nein, sie sind felsenfest entschlossen, "(to) reductively and dangerously demonize any person who shows solidarity with Palestinian liberation." Ominös wabernde Adverbien und Adjektive (weitere Beispiele: problematic, subtly, intentionally und so weiter) gehören zu den verlässlichsten Bullshit-Indikatoren in der zeitgenössischen Aktivistenkultur: Worte, die der eigenen Empörung nicht, das wäre vergleichsweise legitim, direkt Ausdruck verleihen, sondern sie zu objektivieren versuchen. Das eigene Anliegen wird mit ihrer Hilfe ins Schicksalhaft-Überlebensgroße aufgeplustert und damit jeder Gegenrede, die sich nicht auf einen derart selbstbezogen moralinsauren Tonfall einlassen möchte, entzogen.
("Es ist keine Voraussetzung für grundrechtlich geschützten Protest, dass er auf Dialog ausgerichtet ist", formulieren Lehrende an Berliner Hochschulen dieser Tage in einem weiteren offenen Brief. Formal ist das richtig, ja. Aber, hey: wäre es nicht besser, wenn doch?)
...wie aber, um zum Anlass dieses Textes zurückzukehren, ist diese elendige Vorgeschichte hinterher zu bewerten, nach einem krawallfreien und auch sonst weitgehend erfolgreich absolvierten Festivalausgabe? Die diversen diskursiven Verengungen und Verkrampfungen, die unsere Mediengesellschaft prägen, werden wir nicht so schnell los werden. Aber den Beweis, dass es möglich ist, ein anregendes, dem friedlichen Diskurs verpflichtetes und, ja, auch diverses Filmfestival zu organisieren, ohne sich von humorbefreiten Schreihälsen vor sich her treiben zu lassen, den haben die Kurzfilmtage Oberhausen dieses Jahr erbracht.
3

Nicolaas Schmidts "Like Horses Standing in the Rain" war in Oberhausen Teil des Deutschen Wettbewerbs und wurde auf der Preisverleihung mit einer lobenden Erwähnung versehen. Was mich an dem Film fasziniert: dass er eine persönliche, keineswegs auf Verallgemeiner- oder auch nur Übersetzbarkeit abzielende Perspektive auf die Welt entwirft und sich dennoch durchweg weigert, seine Bilder auf eine individuelle Perspektive zuzuschneiden, an einzelne Körper zu binden. Oder höchstens an Pferdekörper, an Körper, denen der filmische Blick äußerlich bleibt. Wenn "Like Horses Standing in the Rain", zwischen 2018 und 2019 unter anderem in Hamburg, Berlin und Leipzig entstanden, ebenfalls einem Tagebuch beziehungsweise scrap book ähnelt, dann einem, das das Wort "Ich" vermeidet; beziehungsweise, präziser, in der Unschärfe belässt. Und obwohl der Film zweimal in ein weihnachtlich geschmücktes Wohnzimmer wechselt, ist auch die Familie für ihn kein zentraler, verlässlicher Bezugspunkt.
Das entkörperlicht Individuelle wird direkt, ungeschützt, mit dem Gesellschaftlichen vermittelt. Mit dem Gesellschaftlichen als einer Totalität, wie sie sich etwa auf belebten, geschäftigen Bahnhöfen offenbart - alle Züge haben Verspätung, wegen Menschen auf den Gleisen - aber keine Sorge, bald sind sie wieder frei; mit dem Gesellschaftlichen als einer Farce, wie sie sich etwa während einer verregneten Weihnachtsfeierlichkeit vor einer Sparkassenfiliale präsentiert. Hier und da auch: mit dem Gesellschaftlichen als einem tröstlichen Ornament, wie es etwa als aufblühendes Feuerwerk im Bildhintergrund über Häuserdächern aufscheint.
Überhaupt ist "Like Horses Standing in the Rain" ein Film der künstlichen Lichter. Der Lichter und der Lichtmaschinen. Wo das Familiäre, auch das im engeren Sinne Autobiografische, keinen Halt mehr bietet, muss die Popkultur einspringen. Schon der eine klassische Figurendialog, den der Film enthält, erweist sich als semantischer Reim auf den tschechoslowakischen Märchenfilmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Später hallt Werner-Herzog-Pathos durchs Weihnachtszimmer. Auf der Tonspur Bach-Klaviermusik, als fernes Echo einer, vom Kunstkino längst gründlich verdinglichten Sphäre bürgerlicher Autonomie. Aber auch R.E.M.: Everybody Hurts.
Lukas Foerster
4

Grob in zwei Hälften lässt sich "Merkur" teilen, die zweite Regiearbeit des langjährigen Spielothekenmitarbeiters und Croupiers Johannes Lehnen, die ebenfalls im Deutschen Wettbewerb präsentiert wurde. Zum einen die Repetition und zum anderen der Blick ins Herz der Finsternis aus ihr heraus. Zwei strenge Versuchsanordnungen, die sich gegenseitig bedingen und erst in gemeinsamer Kulmination ihr Herz ausschütten.
Wiederkehrende Bewegungsschleifen im Bild und eine monotone Untermalung aus Spielautomatengeräuschen auf der Tonspur prägen die erste Hälfte. Buzzer künden von Großem, das jedoch nie eingelöst wird. Von oben nach unten, nach links oder nach rechts und dann wieder zurück laufen die Bildchen auf Spielautomatwalzen in ihrer niedlichen Kitschseligkeit vor sich hin. Lange Zeit bleiben sie das einzige Motiv, das die Kamera aufnimmt, dazwischen sind indes auf ansonsten dunkler Leinwand Unterbrechungsmeldungen zu lesen: Schicksale von Kolleg*innen und Menschen im Bannkreis der Spielothek Merkur 1 in Frankfurt, Geschichten aus dem täglichen Sterben, Anekdoten, die in ihrer kühl vorgetragenen Unglaublichkeit nur für wahrscheinlich halten kann, wer soziale Verelendung kennt. Raubopfer in der und um die Arbeitsstelle, Menschen, die ihren Halt - einen vermeintlichen oder einen echten, man kann es nicht wissen - in religiöser Missionierung oder flüchtigen Beziehungen finden. Es geht um den Aufstieg im innerbetrieblichen System und um eine Taufe im Waschbecken. Wie gesagt: Keine Erzählstimme verleiht diesen Schicksalen Ausdruck, es dominiert die Entmenschlichung via Textkommentar - die, von denen zu lesen ist, könnten allesamt Roboter sein, bloße Räder im Getriebe oder Sternenkrieger*innen von fremden Planeten.
So geht das eine ganze Weile; gleichförmig, mathematisch berechenbar, kalt wie ein Uhrwerk aus Stahl. Es hat etwas von Akkumulation, von Datenerfassung. Erst und ausschließlich in der Summe spricht aus den Texteinblendungen auch Warmherzigkeit, das Mitgefühl eines zwischenmenschlich zum Sammeln Neigenden. Hier hat einer in Pausen, leeren Stunden, vor dem das Funktionale der Brotarbeit besiegelnden Heimweg, genau zu- und hingehört, reingehört in die Strukturen selbst. So wie man es im Beruf nicht tun soll, wie man es systemisch und systematisch aberzogen bekommt. Hier kommt die zweite Hälfte des Films ins Spiel: Johannes Lehnen bewegt sich vom Seelenschinder Slotmaschine rückwärts in ihr Umfeld. Aus Formelhaftigkeit und Berechnung setzt sich ein Todesstern zusammen.
Ins Zentrum rückt nun ein verkleinerter Nachbau der Frankfurter Merkur-Spielothek, ein Ungetüm aus Pappe, künstlicher als der George-Lucassche Original-Todesstern, erschreckender weil real. Eng, schlauchartig, ein Labyrinth der Leidenschaftslosigkeit, ganz so, wie der Text diesen Ort in der ersten Filmhälfte subkutan beschrieben hatte. Visuell aufgelöst in einer gleitenden, stockenden Raumerfassung, streng von oben, Raum für Raum, Pappstück für Pappstück, materiell ge-, durch die filmischen Mittel gefühlt endlos zerdehnt. Irgendwann geht das Licht im Model geht aus, die Rollladen fahren herunter. Wir müssen artig warten.
Immer dystopischer dröhnen Ton- und Musikkulisse - eine Ausweitung der Kampfzone, die klarstellt, durch welch weite Betonödnis diese unentwegt klackernden, klirrenden, pulsierenden Indikatoren von Sucht und Einsamkeit hallen. 48 Maschinen in vier Räumen, jeder Mensch für sich allein, das Kapital gegen alle. Am Ende liegt das Papp-Merkur völlig entblößt in einer Totalen vor uns, ein Weltraumverschlinger, wie Planquadrate aus dunkler Materie, eine Sammlung an Gräben auf einer Oberfläche, deren Kern wir nur dank der vorherigen Texteinblendungen erahnen können. Wann fliegt Luke Skywalker vorbei, um diesen Todesstern zu versenken - wird er kommen? Warten auf den Erlöser.
Seinen erdrückenden Reiz bezieht "Merkur" aus der Widersprüchlichkeit seiner Elemente, die sich im Verlauf des Films in viele kleine Prozesse auflösen. Bild, Ton und Text streben in unterschiedliche Richtungen, bevor sich die Disparatheit zu einem neuen Ganzen vereint. Visuelle Bewegungsformen und akustische Schwingungen erzeugen in nicht auszuhaltender mechanischer Präzision Fatalismus, einen Film als Automat, der mit sprachlichem Input ringt. "Merkur" ist einer der seltenen Filme, die durch das geschriebene Wort mitfühlend werden. Die Schlichtheit der Darstellung wird zum notwendigen Kontrapunkt der kommunizierten Schicksale. Die Neutralität der Form transportiert mehr Regung, als hundert plastisch für die Leinwand aufgearbeitete Einzelschicksale dies könnten. Menschen zu lieben bedeutet, sie alle zu lieben. Manchmal muss dies nicht einmal verbalisiert werden.
André Malberg








 Miranda July: Auf allen vieren
Miranda July: Auf allen vieren Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung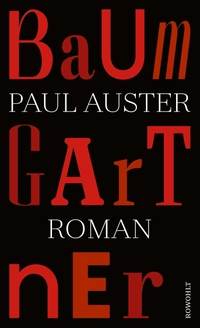 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner